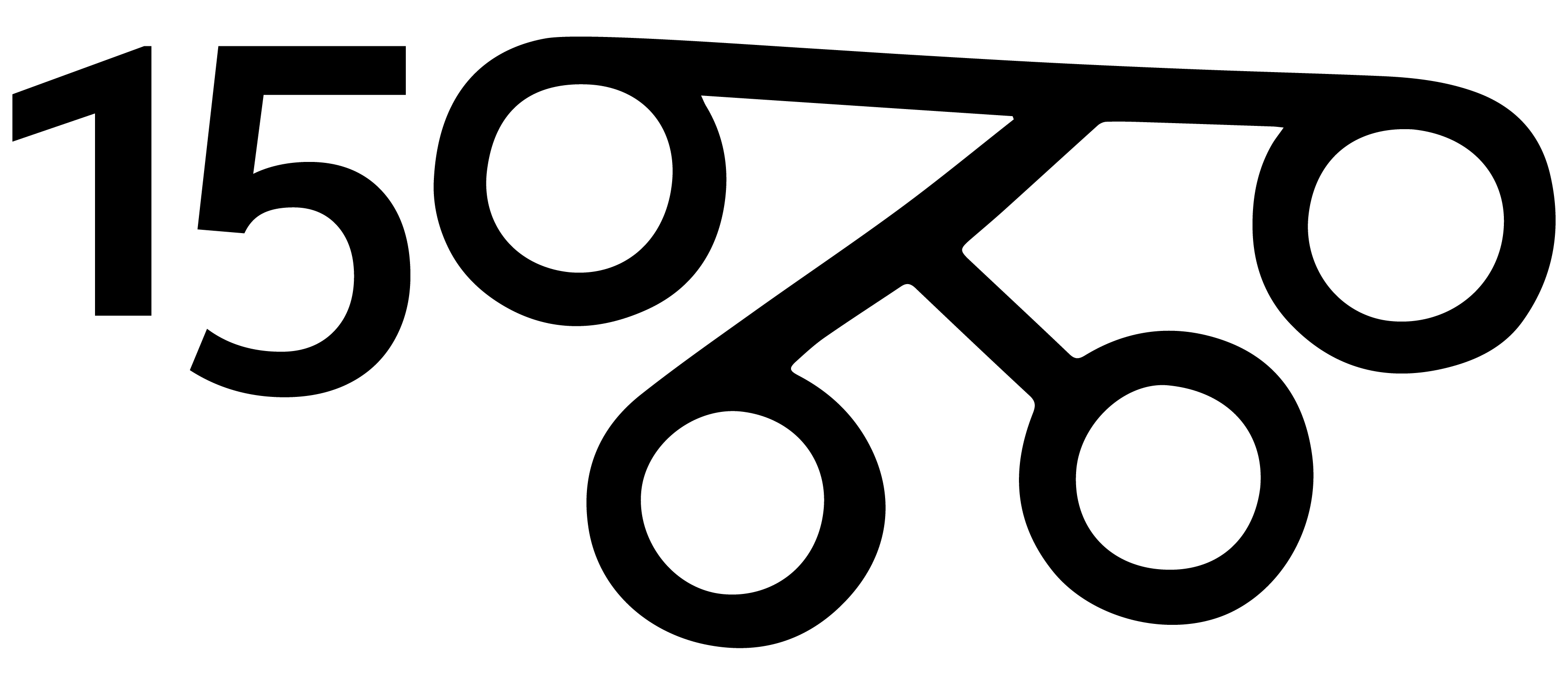Die Zeitschrift Zagreber Germanistische Beiträge veröffentlicht wissenschaftliche Arbeiten, fachdidaktische Berichte, Buchbesprechungen und Konferenzberichte. Die Zeitschrift erhebt keine Gebühren für die Einreichung, Bearbeitung oder Veröffentlichung von Manuskripten. Beiträge in deutscher Sprache; bitte mit Zusammenfassung (bis zu 700 Zeichen) und 3–5 Schlagwörtern. Eingereichte Beiträge, die eine tief greifende sprachliche oder stilistische Lektur benötigen, gehen an Verf. mit der Bitte um Nachbesserung bzw. Lektur zurück. Eingereichte wissenschaftliche Arbeiten werden von zwei GutachterInnen anonym begutachtet. Für Beiträge von Mitgliedern des Instituts, das als Hg. der ZGB zeichnet, werden die Gutachten ausnahmslos aus dem Ausland eingeholt. Eine programmgestützte Fehlerüberprüfung (Rechtschreibprüfung / spell check) gehört zum ›guten Ton‹. Eine tief greifende Lektur (Fehler oder Schwächen in den Bereichen Grammatik, Stil, Argumentation, Transparenz, Kohärenz) kann von der Redaktion nicht geleistet werden – bitte im Vorfeld vermeiden / beheben / beheben lassen.
Alle in Zagreber Germanistische Beiträge veröffentlichten Artikel stehen unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Diese Lizenz erlaubt die nicht-kommerzielle Nutzung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium, sofern der ursprüngliche Autor bzw. die Autorin und die Quelle ordnungsgemäß genannt werden und keine Änderungen oder Bearbeitungen vorgenommen werden. Das Urheberrecht verbleibt bei den Verfasser_innen, und eine korrekte Zitierung ist bei jeder Weiterverwendung erforderlich.
Hinweise zur formalen Gestaltung
Umfang
- Wissenschaftliche Beiträge, fachdidaktische Berichte ä.: bis zu 50.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen und Anmerkungen) – falls im CfA/CfP für den konkreten Themenschwerpunkt nicht anders angegeben!
- Buchbesprechungen, Konferenzberichte: bis zu 15.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen und Anmerkungen)
- Zusammenfassung (für alle Beiträge außer für Buchbesprechungen und Konferenzberichte erbeten): bis zu 700 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)
- Titel und Untertitel des Beitrags insgesamt bitte nicht länger als 150 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)
Äußere Gestaltung
- Schriftgröße 12; Zeilenabstand 1,5
- Absätze einrücken
- längere Zitate (ab vier Zeilen) abgesetzt: Leerzeile davor und danach, Schriftgröße 10, Zeilenabstand 1, ohne Anführungszeichen
- möglichst wenig Formatierung (z.B. keine Randjustierung /justify/, Blockschrift nur für Titel u. Untertitel des Beitrags)
Quellennachweise
- Ab dem ersten Nachweis, in der Fußnote: Nachname und Titel
(bei längeren Titeln ggf. kürzen; dabei Verständlichkeit/Erkennbarkeit des Titels gewährleisten):Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 30; Fleming: Klagegedichte, S. 15.
- Unmittelbare Rückverweise mit »ebd.« (ebenda)
Sprachen
- Nicht deutschsprachige Zitate, deren Verständis bei der Leserschaft nicht vorausgesetzt wird, werden im Fließtext ins Deutsche übersetzt. Das Original folgt in einer Fußnote.
Titelangaben im Literaturverzeichnis
- Monographie, Sammelband, Handbuch
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Simplicissimus teutsch. In: Werke in drei Bänden. Bd. I/1. Hg. Dieter Breuer. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag 1989.
Ambler, Charles Henry: A History of Transportation in the Ohio Valley. Westpoint (Connecticut): Greenwood Press 1970.
Auerbach, Erich: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. 8. Aufl. Bern, Stuttgart: Francke 1988.
Moebius, Stephan; Quadflieg, Dirk (Hgg.): Kultur. Theorien der Gegenwart. 2., erw. u. aktualis. Ausg. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011.
Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Stuttgart, Weimar: Metzler 1998.
- Teil einer Buchpublikation
Fleming, Paul: Klagegedichte über das unschuldigste Leiden und Tod unsers Erlösers Jesu Christi. In: ders.: Deutsche Gedichte. Hg. J. M. Lappenberg. Bd 1. Stuttgart 1865, S. 15–27.
Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. In: Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Hgg. Ansgar Nünning, Vera Nünning. Stuttgart, Weimar: Metzler 2003, S. 156–185.
Unger, Rudolf: Philosophische Probleme in der neueren Literaturwissenschaft [1908]. In: Aufsätze zur Prinzipienlehre der Literaturgeschichte. Gesammelte Studien. Hg. ders. Berlin 1929, S. 1–32, hier S. 13–15 u. 17f.
Dressel, Gert: Wissenschaft und Biographie. In: Sprachkontakte und Reflexion. Hg. Velimir Piškorec. »Zagreber Germanistische Beiträge«, Beiheft 7 (2004), S. 33–71.
- Aufsatz in Periodikum
Krichmeier, Christian: ›Tjam patram‹. Musikalische Poetik beim frühen Brecht. »Zagreber Germanistische Beiträge«, Jg. 26 (2017): Musikalisches Erschreiben, S. 49–74.
Neuner, Gerhard: Zu den Grundlagen und Prinzipien der Mehrsprachigkeitsdidaktik und des Tertiärsprachenlernens. »Babylonia« (2009), Nr. 4, S. 14–17.
Bei doppelter Nummerierung (alte Reihe, neue Reihe o.ä.) oder sonstwie intransparenter Zählung – bitte alle Angaben:
Lovrić, Goran: Peter Handke. Iskušavanje književnih konvencija. »Književna smotra«, Jg. 29 (1997), Nr. 4 (106), S. 93–97.
- Aus dem Internet
Web-Adresse bitte immer in spitzen Klammern: <……>.
Führen Sie nach Möglichkeit die zuverlässigste Adresse an: ein Permalink (Zitierlink) hat Vorrang vor der DOI Nummer, diese hat Vorrang vor einfacher Web-Adresse.
Car, Milka: Unheimliche Nachbarschaften. Der österreichische Einfluß auf die Entwicklung des kroatischen Theaters 1840–1918. In: Kakanien revisited. <http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MCar1.pdf> (Zugriff: 9.11.2005).
Bichler, Josef: Wir lassen uns gerne täuschen [Interview mit Anna Kim]. »derStandard.at«, 7.9.2012. <http://derstandard.at/1345166498910/Wir-lassen-uns-gerne-taeuschen> (Zugriff: 15.12.2012).
Peter Handke et l’autonomie de la littérature. Études réunies par Svjetlan Lacko Vidulić et Jacques Lajarrige. »Austriaca. Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche« 91-92/2021. <https://doi.org/10.4000/austriaca.2874> (Zugriff: 23.12.2024).
Franz Kafka. In: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. <http://de.wikipedia.org/wiki/Kafka> (Zugriff: 1.1.2014).
Duden online. Berlin: Bibliographisches Institut, Dudenverlag. <https://www.duden.de> (Zugriff: 1.2.2019).
Hervorhebungen und Auslassungen
Hervorhebungen möglichst sparsam verwenden und folgendermaßen differenzieren:
- doppelte Anführung (» «) für:
– Zitate
– Titel von Periodika (»Süddeutsche Zeitung«)
- einfache Anführung (› ‹) für:
– Zitat im Zitat
– uneigentliches Sprechen
– Hervorhebung einzelner Wörter, Begriffe und Syntagmen
- Kursivschrift nur für:
– besondere Betonung
– alle Titel (außer Periodika) in Fließtext, Anmerkungen, Literaturverzeichnis
– sparsam bei Namen von Gegenständen, Institutionen, Veranstaltungen
Hervorhebungen und Auslassungen
Hervorhebungen möglichst sparsam verwenden und folgendermaßen differenzieren:[1]
- doppelte Anführung (» «) für:
– Zitate
– Titel von Periodika
die »erotische[n] Wahlverwandschaften« Goethes (=Zitat; verlangt exakte Widergabe sowie Quellennachweis)
»LiLi«; »Kulturpoetik«; »Süddeutsche Zeitung« (=Titel von Printmedien)
»Süddeutsche.de«; »derStandard.at«; »Spiegel online« (=Titel von online-Medien)
- einfache Anführung (› ‹) für:
– Zitat im Zitat
– uneigentliches Sprechen
– Hervorhebung einzelner Wörter, Begriffe und Syntagmen
»Da sagte sie: ›O!‹, und schlug sich vor die Stirn.« (=Zitat im Zitat)
die ›wahre‹ Erkenntnis (=uneigentliches Sprechen)
die Begriffe ›Paradigma‹ und ›Syntagma‹ (=hervorgehob. Fachtermini u.a.)
›Wahlverwandtschaften‹ in der Art Goethes (=hervorgeh. Prägung eines Autors oder Diskurses)
- Kursivschrift nur für:
– besondere Betonung
– alle Titel (außer Periodika) in Fließtext, Anmerkungen, Literaturverzeichnis
– sparsam bei Namen von Gegenständen, Institutionen, Veranstaltungen
nicht einmal modern sein, sondern immer modern sein (=hervorgehob. Sinnbetonung)
Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang Goethe (=Titel)
das SS City of Brooklyn (=Hervorhebung steigert Verständlichkeit)
die Titanic / die Titanic
Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt
- fett: nur für Zwischentitel, bei Wortlisten in linguist. Analysen u.ä.
- eckige Klammern: für Auslassungen und Ergänzungen
»Zugegeben: ich [Oskar] bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt, mein Pfleger beobachtet mich, […]; denn in der Tür ist ein Guckloch«; die »Heil- und Pflegeanstalt[en]« bei Günter Grass
…der verstärkten ethischen Haltung… → eine »verstärkte[ ] ethische[ ] Haltung«
Abkürzungen
- , ebd. [=ebenda, in der zuletzt erwähnten Quelle]
– wenn selbständig in der Fußnote – großes E, Punkt am Ende:
Ebd., S. 100.
– wenn in Klammern (Fließtext oder Fußnote) – kleines e, ohne Punkt:
…Ende eines Zitats.« (ebd., S. 100) - Frankfurt/M.
- mit geschütztem Leerzeichen (ctrl + shift + Leertaste):
dgl.
5 %, 5 €, 5 £, § 5
- W. Goethe, J. B. Metzler, C. H. Beck
- ohne Leerzeichen (evtl. Umstieg auf geschütztes Leerzeichen?):
B., u.a., u.U., z.Z., d.h., u.d.T.
Zeichensetzung, Zeichentypen
- das große Eszett (ẞ): seit 2017 Bestandteil der amtlichen deutschen Rechtschreibung; Eingabe u.a. mit folgender Tastenkombination: ⇧+Alt Gr+ß (ab Windows 8)
- kurzer Strich nur als Bindestrich, allen anderen Zwecken dient der längere Strich, z.B.:
Österreich-Ungarn
Unfall-Versicherung
- 10–15
1968–2008
- Schrägstrich – im Prinzip ohne Leerzeichen davor und danach; mit Leerzeichen in den folgenden Fällen (der Lesbarkeit wegen):
- Gedichtzeilen im Fließtext (»Habe nun, ach! Philosophie, / Juristerei und Medizin, /«)
- längere Einwortserien (Buche / Eiche / Esche / Tanne) oder Mehrwortgruppen (Milka Car / Jelena Spreicer)
- Apostroph: l’art pour l’art, Grass’ Blechtrommel, James Joyce’s Roman, die Grimm’schen Märchen (oder: die grimmschen Märchen)
- der Anmerkung, die sich auf einen ganzen Satz, einen Teilsatz oder auf ein Wort/Syntagma am Ende des (Teil-)Satzes bezieht – jeweils nach dem letzten Interpunktionszeichen setzten [also abweichend von der Duden-Regelung]:
- Dies sei eine Lüge (so der Autor wörtlich).1
- Diese »Kultur der Lüge«,2 mit den Worten von Dubravka Ugrešić,
- aber: Diese »Kultur der Lüge«2 ist weit verbreitet.
- Wird ein ganzer Satz oder ein Satzanfang zitiert, ist das Schlusszeichen dieses Satzes in das Zitat einzuschließen:
- Der Psychoanalytiker Zichroni bekennt: »Ich bin, woran ich mich erinnere. Etwas
anderes habe ich nicht.« (W, S. 121) Dieses Bekenntnis…
- Dort heißt es: »Im Anfang war das Wort […].«25
- Bei zitierten Syntagmen und Satzteilen gehört das Schlusszeichen des zitierten Satzes nicht zum Zitat:
- Erinnerungen gehören »zum Unzuverlässigsten […], was ein Mensch besitzt«.13
- Ohne Konzept kein Projekt, denn »[i]m Anfang war das Wort«.6
- Duden-Regel 98: »Werden Teile eines zusammengesetzten Substantivs eingeklammert, kann auch ein Ergänzungsstrich gesetzt werden.« Zum Beispiel:
- (Wieder)eintritt oder (Wieder-)Eintritt
- Gewinn(anteil) oder Gewinn(-Anteil)
- Die Abkürzungen und s.:
– vgl. für den Nachweis nicht-wörtlicher Übernahmen (Paraphrasen) oder gedanklicher Anlehnungen
– s. für den Verweis auf weiterführende Literatur
oder???? :
– ›vergleiche‹ für den Nachweis nicht-wörtlicher Übernahmen (Paraphrasen) oder gedanklicher Anlehnungen
– ›siehe‹ für den Verweis auf weiterführende Literatur - Diverse Zweifelsfälle:
›close reading‹-Verfahren
[1] Wird bei der Hervorhebung nicht differenziert, bleibt oft unklar, ob es sich um ein exaktes Zitat, einen kontexttypischen Begriff oder um uneigentliches Sprechen handelt. Vgl.:
…Alfred Gern und Paul Riedel betreiben in der Gestaltung der Liebe eine poetisch-philosophische Gestaltung »elementarer Probleme des Menschenlebens« (Gern 2048, S. 30). Diese »Problemgeschichte« findet ihren Niederschlag in Alfred Gerns Romantrilogie…